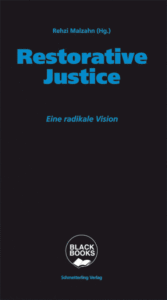Vor einigen Tagen erreichte mich der Change.org Link zum «Manifest der Achtzigjährigen», einer Initiative der von mir sehr geschätzen Ivan Illich -SchülerInnen Marianne und Reimer Gronemeyer. Sie erheben als Kriegskinder ihre Stimmen gegen den Krieg in der Ukraine und vor Allem eine Politik, die diesen vorantreibt anstatt auf Frieden zu drängen. Es ist ein eindringlicher, aus eigenen fürchterlichen, traumatischen Erfahrungen gespeister Text, der deutlich machen möchte, dass Krieg «kein Gegenstand wie jeder andere» ist. Er macht nachfühlbar, wie stark die Erfahrungen des Krieges als Kind diese Generation geprägt hat, auch in den Kommentaren der Unterzeichner:innen, wie sehr es ihnen graut, wie bedroht sie sich fühlen, insbesondere vor den Möglichkeiten einer «Atommacht».
Als langjährige und begeisterte Teilnehmerin der jährlich veranstalteten Sommeruniversität des Illich-Kreises und Co-Autorin zweier Bücher zu Ehren der beiden Achtzigjährigen fühle ich mich berufen, aus der Perspektive einer «Halb-so-Alten» zu erwidern. Dies tue ich in Respekt und Bewunderung für ihre Klugheit und ihr Denken und im Bewusstsein, dass ich nicht ihre starken sprachlichen Möglichkeiten habe. Auch mangelt es mir an Zeit, lange an diesem Text zu feilen, es drängt mich aber, meine Erwiderung zu Gehör zu bringen.
Ich sag es gleich: ich fühle diesen Schrecken so nicht.
Nicht weil ich denken würde, eine Atombombe sei harmlos oder der Krieg in der Ukraine nicht schlimm. Im Gegenteil. Er geht mir durchaus nahe und er ist es auch. Ein befreundeter Imker und Fruchtweinhersteller wurde ausgebombt. Alle Bäume, alle Bienen, alles tot. Wir haben ihn finanziell unterstützt und wünschen uns, eines Tages mit ihm zusammen neue Bäume zu pflanzen. Ein Freund meiner Schwester ist in den ersten Tagen des Krieges bis an die ukrainische Grenze gefahren, um befreundete Künstler:innen, die sie noch im Vorjahr in Kiew besucht und mit ihnen Performances gemacht hatten, abzuholen und in Sicherheit zu bringen. Ich habe also durchaus direkten Kontakt mit diesem Krieg.
Es ist mir aber sehr komisch, wie sehr dieser Krieg plötzlich Leuten nahe geht. Es ist ja nicht so, als wären die letzten Jahre kriegsarm gewesen. Im Jemen und in Ethiopien wütet seit langem ein von der Weltöffentlichkeit weitgehend unbeachteter Krieg. Der Angriff auf den Irak hat mich 2003 sehr aufgewühlt, das Fallen der Bomben auf Bagdad habe ich gespürt. Als politische Aktivist:innen haben die Aufstände der Arabellion 2010/2011 intensiv begleitet und ihre Niederschlagung sowie der immer noch währende Krieg in Syrien hat uns niedergeschmettert. So viele der Aktivist:innen, mit denen wir in Kontakt waren, sind getötet oder gefoltert worden, verschwunden oder geflüchtet. Dieser Krieg ist nicht zu Ende und die «Atommacht» Russland mischt hier kräftig mit. Weit weg ist Syien auch nicht – es grenzt an das Mittelmeer, an Israel und die Türkei. Odessa liegt in ählicher Entfernung! Warum rührt also jetzt dieser Krieg so an?
Und richtigerweise muss es heißen: diese Phase des Krieges. Denn Russland führt seit mindestens 10 Jahren Krieg gegen die Ukraine, seit 2014 offen, davor auch verdeckt. Cyberangriffe auf die Infrastruktur haben das Land immer wieder lahmgelegt und viele Sicherheitsexpert:innen weltweit ganz schön erschreckt. Bis heute weiß niemand, wieviel russische Malware auf den Rechnern von Elektrizitätswerken und anderer Infrastruktur in wievielen Ländern schlafen, um eines Tages geweckt zu werden und einen Blackout zu produzieren. Es ist falsch, den Teufel nicht beim Namen zu nennen: Putin, nicht Russland, nicht eine «Atommacht» verfolgt eine klare Agenda, welche keineswegs geheim ist. Das Strategiepapier des mystischen-faschistischen Theoretikers Alexander Dugin, dem Putin nahe ist, liest sich wie eine To-Do Liste, und man kann gut sehen, was bereits abgehakt wurde: Europa destabilisieren durch die Stärkung antidemokratischer Kräfte (Putin finanziert diverse rechtsextreme Parteien, darunter die FPÖ, den RN und die AfD) und Meinungsbeeinflussung mittels »Trollarmeen« auf Social Media, Großbritannien aus der EU lösen (die Brexitkampagne wurde von Putin finanziert), die Trumpwahl wurde mit Hilfe des Kremlins manipuliert, auch hier das Ziel der Destabilisierung, und ein Großteil der Verschwörungserzählungen, die so im Umlauf sind, werden von kremlgesteuerten Agenturen erfunden. Das sind nur einzelne Beispiele dieser langfristig angelegten und seit Jahren verfolgten Strategie Putins. Auf der Liste steht auch: sich Osteuropa einverleiben, inklusive Finnland, und Rest-Europa unter russischen Einfluss bringen. Wer in letzter Zeit mit Menschen aus Osteuropa gesprochen hat, konnte lernen, dass sich viele dieser Gefahr seit langem bewusst sind. Deswegen fällt die Reaktion dort auch entsprechend eindeutig aus. Und alle sind sich einige: niemand will unter Putin’scher Herrschaft leben! Auch ich nicht, übrigens, allein schon wegen meiner homo- und transsexuellen Freund:innen.
Es hat überhaupt keinen Sinn, einen Standpunkt zu erarbeiten, ohne all diese Dinge einzubeziehen. Die Frage, die sich dann stellt, lautet: wie mit jemandem einen Verhandlungsfrieden erreichen, der überhaupt nicht verhandeln will, weil ihm ein schlimmer Krieg mit hohen eigenen Opfern nichts ausmacht und er durch eine Verhandlung nichts zu gewinnen hat? Putin führt einen genozidalen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, das ist kein Geheimwissen, sondern wird in Russland offen so gesagt. Es wird aller Anstrengungen bedürfen, um diesen Mann in seine Schranken zu weisen, und aus der Geschichte und der Gegenwart kann man lernen, dass man solche Machthaber nicht »appeasen« kann. Es scheiterte bei Hitler, es scheitert bei Erdogan, und was passiert, wenn sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden, erleben die US-Amerikaner:innen gerade sehr schmerzhaft mit Trump und seinen Anhänger:innen.
Es ist die Zeit der Monster (Gramsci/Zizek), und es ist wichtig sie zu benennen! Die Liste ist nämlich noch länger. Duterte, Bolsonaro, Orban, Johnson und auch ein Macron gehören da hinein. Schreckliche narzisstische Männer, Männer, die ihren Mangel an Zärtlichkeit mit Machtgier und eiskalter Grausamkeit ausgleichen. Und sie werden flankiert, um im Kriegsvokabular zu bleiben, von einer ganzen Reihe an Möchtegernen wie Sebastian Kurz und Christian Lindner, toxischen Milliardären wie Musk und Bezos und einer allgemeinen Tendenz zum Autoritären, der sich in fast allen Regierungen breitgemacht hat.
Diese Faschisierung ist da, konkret spürbar und macht mir mehr Angst als alle Atombomben. Nicht nur, weil sie die Wahrscheinlichkeit der Nutzung einer Atombombe erhöhen, sondern auch, weil ein Atomkrieg im Vergleich zum täglichen Morden und Foltern in autoriären Regimes verdammt unwahrscheinlich bleibt. In Frankreich aber muss man sich inzwischen die Frage stellen, ob man bereit ist, sein Leben und seine Unversehrtheit zu riskieren, wenn man auf eine Demo gegen die Rentenreform oder eine Großbaustelle (zB. Sainte-Soline) geht. Hier führt die Polizei Krieg gegen die eigene Bevölkerung, mitunter mit Waffen wie CN Gas, welche im Krieg verboten sind. Frankreich ist eine sogenannte Demokratie im Zentrum der EU und Deutschlands Nachbar! Das bedeutet auch, dass man sich die Frage stellen muss, wann und unter welchen Bedingungen der dem Manifest so wichtige gewaltfreie Widerstand möglich und sinnvoll ist.
Das Manifest erwähnt den Widerstand gegen den Hitlerfaschismus als einzig legitime, historische Ausnahme für eine ansonsten pazifistische Haltung. Tatsächlich aber muss sich Widerstand immer seiner Möglichkeitsbedingungen bewusst sein, und die sind historisch konkret! Es ist überhaupt nicht gesagt, dass Gandi zu einem anderen Zeitpunkt des britischen Kolonialismus mit seiner Methode Erfolg hätte haben können (ich fürchte, indigene Menschen haben andere Erfahrungen machen müssen). So wie französische Aktivist:innen schmerzlich erfahren mussten, dass die gewaltfreien Methoden der britischen Reclaim The Streets Bewegung in Frankreich nicht funktionieren, weil im Gegensatz zur englischen Polizei der Neunziger Jahre, die vorsichtig vorging, die französische Polizei Anfang 2000 überhaupt kein Problem damit hatte, äußerst brutale Räumungen durchzuführen, bei denen sie Leib und Leben der Aktivist:innen riskierte. Auch der deutsche Widerstand gegen Atomtransporte zählte darauf, dass der Zug langsam genug fährt, um reagieren zu können, die Polizei die Aktivist:innen vom Gleis trägt und angekettete Menschen vorsichtig mit Spezialgerät loslöst. In Frankreich gibt es keinerlei solcher Vorsichtsmaßnahmen, was einem Aktivisten das Leben gekostet hat, weil er nicht mehr rechtzeitig vom Gleis kam und der Zug ihn erfasste. Andere mussten erleben, dass ihnen ohne Rücksicht auf Fleischwunden die Ketten abgeflext wurden. Die kurdische Bewegung hat auf die Frage der Gewalt stets geantwortet, dass sie die Waffen nicht lieben, sie aber in einem genozidalen Krieg, der ihnen von der türksichen Regierung aufgezwängt wird, keine andere Möglichkeit sehen, um sich zu verteidigen. Wenn jemand einen Vorschlag habe, wie sie ohne Waffen gegen ihre Vernichtung Widerstand leisten könnten, möchten sie ihn sich gerne anhören. Und es waren diese Kurd:innen, die große Gebiete vom Islamischen Staat befreit haben, unter großen Opfern, mit Waffengewalt. Ohne sie würde es noch viel düsterer aussehen dort. Wie lange die komplett gewaltfreie iranische Revolutionsbewegung so weitermachen kann, ist auch unklar. Denn auch sie hat es mit einem Gegener zu tun, der keinerlei Skrupel kennt und sich vor internationalen Konsquenzen nicht fürchten braucht. Die Frage, ob man zu Waffen greift oder nicht, muss man konkret entscheiden, angesichts eigener Möglichkeiten und der Situation, in der man steckt. Niemand würde doch heute die Entscheidung griechischer, französischer, italienischer oder jugoslawischer Partisanen, bewaffneten Widerstand zu leisten, falsch finden. Niemand würde den Warschauer Ghettoaufstand verurteilen. Dagegen war jedoch das meiste des «bewaffneten Kampfs« im Nachkriegs-Europa ein ziemlicher Unsinn und das haben auch damals schon viele so gesehen.
Ich sehe mich nicht in der Lage, den Ukrainer:innen vorzuschreiben, wie ihr Widerstand auszusehen hat, zumal die meisten hierzulande noch nicht einmal die Verfasstheit ihres Gegners richtig zu beschreiben in der Lage sind. Natürlich profitiert der westliche Machtblock (in welchem viele Machthaber mehr oder weniger heimlich gerne Putin wären) von der Lage. Das kann man auch denunzieren, die Nato ist nicht mein Freund, sie töten meine kurdischen und anderen Gefährt:innen anderswo. Aber wenn wir von Bedrohung und Bedrohungsgefühl sprechen, dann muss schon die ganze Situation eingehend betrachtet werden, und die lässt sich nicht auf eine Atombombe reduzieren. Darauf zu starren wie das Kaninchen auf die Schlange, verkennt, dass Putin mit der Angst spielt, vergisst die vielen anderen Gefahren, in denen wir alle bis zum Hals stecken.
Mein Lebensgefühl ist seit geraumer Zeit das einer allgemeinen permanenten Bedrohung. Es ist völlig unwahrscheinlich, dass ich und meinesgleichen das Alter der ManifestautorInnen erreichen werden. Die abgesicherte Situation, in der ihr lebt und gelebt habt, wird mir niemals zuteil werden! Ich kann mir die notwendigen Zahnbehandlungen schon lange nicht mehr leisten und jongliere mit Provisorien herum, in der Hoffnung, dass alles noch eine Weile hält. Krank werden sollte man nicht, weil die Notaufnahmen überfüllt, die Krankenhäuser unterbesetzt und das Gesundheitssystem insgesamt völlig kaputt ist. Die Mutter einer Freundin hat kürzlich 24h in einem Krankenwagen vor der Notaufnahme verbracht, weil kein Bett mehr frei war. Ebenfalls in Frankreich wurden die lebensrettenden Stents, die Menschen bei Infarkten eingesetzt werden, aus den Erstattungsleistungen herausgenommen. 1500€ kostet ein Stent. Zwei unserer Freunde wären nach diesem neuen Gesetz wahrscheinlich tot, weil sie kürzlich mehrere davon brauchten und das nicht hätten bezahlen können. Dazu kommt meine Erfahrung als Long Covid Leidende, die in ihrem Freundeskreis mittlerweile zwei weitere Menschen mit LongCovid bzw PostVax Syndrom hat und mit Bestürzen und großer Bekümmerung die neue Sorglosigkeit betrachtet, mit der so getan wird, als sei alles vorbei und Covid nur ein Schnupfen oder eh nicht existent. Da wird dann die Sache mit den Stents auch noch mal brisanter, weil ich jetzt ein erhöhtes Infarktrisiko habe, und dass Covid mein Herz angreift, konnte ich in den letzten 3 Jahren immer wieder ganz konkret erleben. Überhaupt Covid, dieses Fenster, durch das ich neuerdings den Hauch der Eiseskälte spüre, die diese Gesellschaft Behinderten, Schwachen und chronisch Kranken entgegenbringt. Ich kann mich da an meiner eigenen Nase packen, auch ich habe mir früher keine großen Gedanken darüber gemacht, muss mir eingestehen Teil des kalten Hauches gegenüber Behinderten gewesen zu sein. Es raubt einem buchstäblich die Sprache, wie man von heute auf morgen wertlos wird, keiner Beachtung mehr würdig. Rücksicht scheint neuerdings ein Schimpfwort, Privilegierte bestehen nun darauf, keine Einschränkungen mehr erdulden zu müssen, das Tragen einer Atemschutzmaske gerät Leuten zur Behinderung – wenn sie doch ahnen würden, was Behinderung wirklich heißt! Für mich und Millionen Leidensgenoss:innen, chronisch erkrankt und nun vulnerbabel, jedes Infektionsrisiko zu meiden verpflichtet – weil wir aus eigener leiblicher Erfahrung wissen, was Covid ist, und weil wir von unseren Kumpan:innen, denen es bereits schlechter geht als uns, wissen, was uns bevorsteht – für uns bedeutet diese «Freiheit!»-brüllende Verweigerung jeder Solidarität, die zu viel Ähnlichkeit mit dem vollgasverliebten Tempolimitwiderstand hat, dass wir völlig an den Rand gedrängt und von Teilhabe ausgeschlossen sind. Freiheit, dieses Wort, auch bereits jeder Bedeutung entleert. Zu viele haben es längst mit Egoismus verwechselt. Zu was eine Gesellschaft fähig ist, die so verroht, so eiskalt ist, möchte ich lieber nicht wissen, aber mir ist ziemlich klar, dass das erst der Anfang war und es in der nächsten Zeit viel, viel schlimmer kommen wird. Auch diese Bedrohung erlebe ich konkret, leiblich, täglich.
Ich merke, diese Erwiderung wird lang, weil in der Kürze des Manifests so viel fehl geht. Denn über die Klimakatastrophe haben wir noch gar nicht gesprochen. Seit heute, dem 8. April 2023, gelten an meinem französischen Domizil Wasserrestriktionen. Wasser darf nur noch zum Duschen und Kochen verwendet werden. Es hat im ganzen westlichen Mittelmeerraum, Italien, Frankreich, Spanien, seit einem Jahr gar nicht oder fast nicht geregnet. Die Brunnen sind leer, der Grundwasserspiegel ist auf einem Niveau, das nach einem trockenen Sommer im August üblich wäre, und der Sommer, der steht uns ja erst noch bevor. Niemand weiß, was werden wird, wie die Vegetation das überleben soll. Die Böden sind von der Oberfläche bis in die Tiefe knochentrocken. Es gibt die ersten Waldbrände. Seit zwei Jahren habe ich jeden Frühling Angst vor dem Sommer, jetzt habe ich schon Angst vor dem Frühling.
Wirklich, die Atombombe ist weit weg. Für mich ist sie ein Problem, das sich vielleicht eines Tages zu den anderen hinzufügen wird. Vielleicht ist Krieg ja doch ein Gegenstand wie mancher andere, wenn diese anderen Ökozid und Faschismus heißen. Vielleicht ist dieser Krieg auch nur ein weiterer Krieg in einer Reihe von all den anderen, mit denen wir seit Jahren mehr oder weniger gleichgültig leben, und sehr wahrscheinlich ist er erst ein Vorgeschmack auf das, was unweigerlich noch kommen wird, wenn wir es nicht zu verhindern vermögen, weil wir die Gefahren verkennen. Die Welt ist ins Rutschen geraten, 2020 ging die Lawine ab, sie hat sich jahrelang aufgetürmt, nun rollt sie. Vielen Menschen sind die Maßstäbe und Orientierungspunkte abhanden gekommen, sie geben sich Hysterien und Wahnvorstellungen hin, auf der Suche nach Halt in dieser immer schneller rollenden Kugel. Auch das macht mir Angst. Es wird nie wieder so sein wie 2019. Die Pandemie war nur ein Auslöser. Die Parameter haben sich verändert, die alten kommen nie mehr zurück. Die Welt rutscht und niemand weiß, wohin, wie lange und was alles dabei verloren geht, zerstört wird.
Von außen betrachtet ist diese Situation aber nur für uns privilegierte Erstwelter:innen neu. Wer indigenen oder anderen kolonialisierten Stimmen zuhört, kann sehr viel darüber lernen, wie man in permanentem Krieg, permanenter Ungewissheit, extremer Prekarität und Entrechtung umgeht, sie tun das seit Jahrhunderten. Wie man darin klug bleibt, überlebt und kämpft. Wer der Gegner ist und wie er funktioniert. Vielleicht ist das die erste Daumenregel, und war es immer: Frag zuerst die Unterdrückten in einer Konstellation, wenn du verstehen willst.